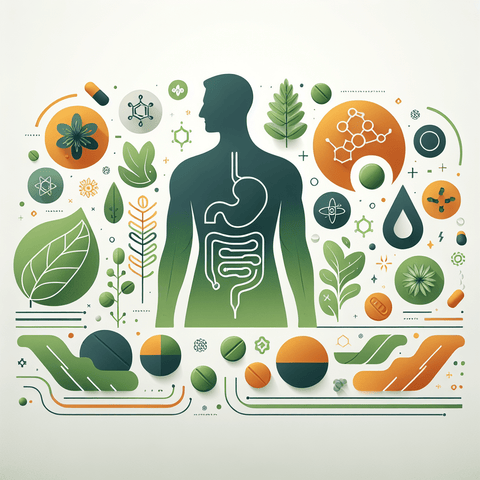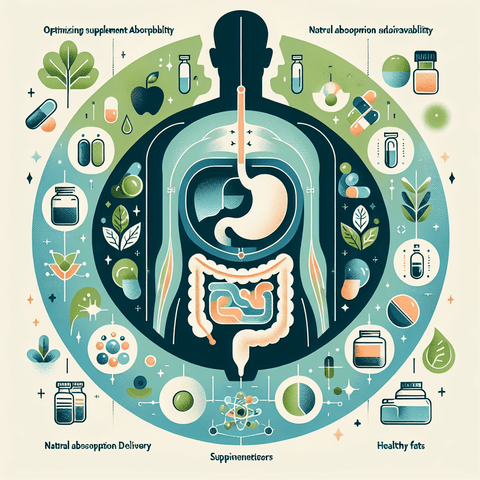Die Bioverfügbarkeit ist der Anteil einer verabreichten Dosis, der letztendlich in aktiver Form den systemischen Kreislauf erreicht. Sie erfasst den Weg des Wirkstoffs von der Verabreichung über Freisetzung, Löslichkeit, Aufnahme, Metabolismus und Verteilung in die Gewebe, wo er wirken kann. In der Pharmakokinetik und Formulationswissenschaft wird die Bioverfügbarkeit häufig zwischen verschiedenen Verabreichungswegen verglichen, wobei eine intravenöse Dosierung als Referenzpunkt dient, der Absorptionsbarrieren umgeht, während andere Wege je nach überwundenen Barrieren unterschiedliche Grade der Bioverfügbarkeit aufweisen. Mehrere Faktoren beeinflussen die Bioverfügbarkeit. Chemische Eigenschaften wie Löslichkeit, Permeabilität, Molekulargewicht und chemische Stabilität bestimmen, wie leicht sich ein Molekül löst und Membranen überschreitet. Formulierungsentscheidungen – Partikelgröße, Feststoffform, Hilfsstoffe und Applikationssystem – können die Löslichkeitsrate und den Schutz vor Abbau verändern. Physiologische Bedingungen, einschließlich des pH-Werts am Aufnahmeort, Transitzeit durch den Gastrointestinaltrakt und regionale Blutversorgung, wirken ebenfalls auf die Menge des verfügbaren Wirkstoffs ein. Der First-Pass-Effekt, insbesondere bei bestimmten Verabreichungswegen, kann den systemischen Anteil vor Erreichen des Kreislaufs weiter verringern. Praktische Hinweise zur Erforschung und Optimierung der Bioverfügbarkeit in einem Entwicklungs- oder Forschungsumfeld umfassen die Auswahl eines geeigneten Verabreichungswegs und die Berücksichtigung formulierungstechnischer Strategien, die die Löslichkeit und Stabilität modulieren. Techniken wie die Verringerung der Partikelgröße, die Erforschung von Salzformen oder Polymorphen zur Beeinflussung der Löslichkeit sowie der Einsatz von Trägersystemen oder Solubiliesierern sind gängige Ansätze, um das Bioverfügbarkeitsprofil zu gestalten. In vitro-Löslichkeitsprüfungen und pharmakokinetische Modelle bieten Werkzeuge, um vorherzusagen, wie Änderungen an der Formulierung oder der Verabreichungsroute den Anteil beeinflussen, der in vivo bioverfügbar wird. Zur Quantifizierung der Bioverfügbarkeit vergleichen Wissenschaftler die systemische Exposition nach nicht-intravenöser Verabreichung mit der nach einer intravenösen Referenz, wobei typischerweise das Verhältnis der Flächen unter der Konzentrations-Zeit-Kurve (AUC) angegeben wird. Dieser Parameter verdeutlicht, warum die gleiche nominale Dosis in Abhängigkeit von Formulierung und Verabreichungsweg unterschiedliche systemische Konzentrationen erzeugen kann. Das Verständnis der Bioverfügbarkeit erfordert die Integration von Chemie, Formulationswissenschaft und Physiologie, um den Weg von der Verabreichung bis zum systemischen Kreislauf nachzuvollziehen.